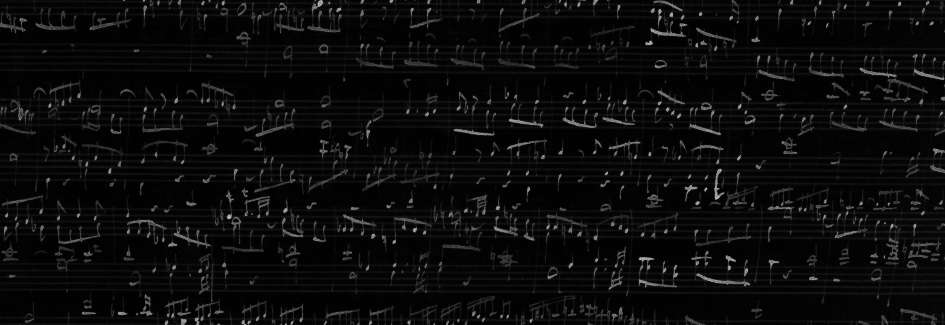Der britische Komponist und Dirigent George Benjamin wurde 2023 mit dem Ernst von Siemens Musikpreis geehrt. Seine schwärzeste Oper Lessons in Love and Violence dreht sich um das historische Männerpaar Edward II. und Piers Gaveston. Ab diesem Wochenende ist sie in einer Neuproduktion am Opernhaus Zürich zu sehen. Moritz Weber interviewte Benjamin vor der Premiere.
Moritz Weber
Der 63-jährige George Benjamin ist sehr gut gelaunt, scherzt und ist sehr freundlich, als ich ihn per Videokonferenz bei sich zuhause erreiche. Im Hintergrund zwitschern die Vögel, die Sonne scheint ihm ins Gesicht.

Die Opern, die er komponiert und für die er unter anderem berühmt ist, sind jedoch alles andere als freundlich. Im Gegenteil: In seinem ersten Welterfolg Written on skin (2012) serviert der betrogene Ehemann seiner Frau zum Schluss das Herz ihres Geliebten zum Essen. Und seine nächste abendfüllende und ebenso umjubelte Oper Lessons in Love and Violence (2018) ist ein fesselndes Mittelalter-Drama rund um den einstigen englischen König Edward II. und seinen Geliebten Gaveston, die beide Opfer eines Komplotts wurden.
Schon als Kind träumte Benjamin davon, Opern zu komponieren, und er erdachte sie für sich in seinem Kopf. Waren die Themen für diese Fantasieopern auch schon so brutal? «Ja, ich fürchte sie waren sehr brutal. Ich mochte dramatische und gefährliche Geschichten, und ich hatte als kleines Kind keine Angst vor Dunkelheit in der Kreativität». Seine ersten Lieblingsopern des Repertoires waren denn auch Wozzeck, Elektra, Salome und La damnation de Faust – mit Mozarts Zauberflöte konnte er nicht viel anfangen, und mit Rossini hat er bis heute Probleme. «Das war mir zu nett und zu wenig beängstigend».
Seine Inspiration damals war ein bebildertes Buch mit alten Mythen und Legenden, von Herkules und Pegasus bis zum Rattenfänger von Hameln (letztere Geschichte wurde schliesslich zum Stoff seines ersten Bühnenwerks, der kurzen Zwei-Personen-Kammeroper Into the little hill (2006). «Ich bin sehr für Fröhlichkeit und für Harmoni zwischen den Menschen, aber im Theater braucht es Spannung, Drama, Mysteriöses und möglicherweise auch Dunkles».
König Edward II. vernachlässigte sein Volk und seine politischen Geschäfte, er gab lieber Geld aus für Kunst und Musik und war Piers Gaveston vollkommen verfallen. Es war George Benjamin wichtig, einmal eine Oper mit einem homosexuellen Paar im Zentrum zu schreiben, «und die grösste Herausforderung war eine technische: Wie schreibt man in einer modernen Klangsprache für ein Paar von zwei Baritonen?»
Überhaupt gibt es in der Operngeschichte bislang kaum Vorbilder für Männer-Liebespaare, abgesehen etwa von den Opern Brokeback Mountain (Charles Wuorinen, 2014) oder Edward II (Andrea Lorenzo Scartazzini, 2017).
In diesen beiden Werken singen die Geliebten allerdings in den Stimmlagen Bariton und Tenor. Auf die Frage, ob er in die Komposition dieser Männerliebe auch Autobiographisches eingebracht habe antwortet Benjamin: «Das müssten sie meinen Partner Michael Waldman fragen, aber soweit ich weiss nicht. Das Leben heute in West-London ist aber auch viel friedvoller als damals in jenem Palast, wo die Oper spielt», sagt er und lacht.
Benjamin sind einige eindringliche Szenen zwischen Edward und Gaveston gelungen, in welchen sich Liebe und Gewalt teils auch vermischen. Zwei Handlese-Szenen etwa (Szenen 3 und 6), die eine Achse durch das ganze Stück bilden. Sie sind mit fast rituellen Klängen von Perkussionsinstrumenten aus aller Welt untermalt: Von zwei persischen Tombaks, einer afrikanischen Sprechtrommel und zwei karibischen Tumbas. Dazu kommt das mitteleuropäische Cymbalon, «denn meine Idee war es, dass Musik aus der ganzen Welt erklingt, während Gaveston aus der Hand des Königs liest. Es sollte wie ein Fenster zum Übernatürlichen sein.»
Eine weitere Schlüsselszene spielt sich kurz darauf im Theater ab. Dort lädt die betrogene Königin Isabel Edward und Gaveston zu einem «Entertainment» ein, zu einer Unterhaltung. Damit will sie den Putsch in die Wege leiten. Die Musik ist vielschichtig, denn das, was auf der Bühne gezeigt wird, soll sich von dem, was sich zwischen den Protagonist:innen abspielt, abheben und gleichzeitig damit harmonieren. Das Bühnenstück dreht sich um die alttestamentliche Liebesgeschichte zwischen David und Jonathan, ebenfalls ein Männerpaar, und Gaveston soll mit dieser Aufführung becirct werden. «Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um diese Szene zu schreiben: Im Theater auf dem Theater singen hohe Stimmen in einer eigenen Textur und Klangfarbe, hinzu kommt der versteckte Hass und das Unbehagen». Sie kulminieren schliesslich und Gaveston wird gegen den Willen des Königs verhaftet. Am Ende der Oper lädt schliesslich der Thronfolger seine Mutter Isabel zu einem Entertainment ein, in welchem er das Komplott gegen seinen Vater auf die Bühne bringt und ihren Komplizen und Geliebten ermorden lässt. Edwards Sohn hat also seine Lektionen in Liebe und Gewalt gelernt.
Auch für diese seine bisher finsterste Oper hat George Benjamin intensiv mit den Sänger:innen der Uraufführungsproduktion am Royal Opera House zusammen gearbeitet. «Sie alle kamen zu mir nach Hause, ich habe sie am Klavier in Liedern und Opernarien begleitet, ihnen viele Fragen zu ihren Stärken und Schwächen und zu ihren musikalischen Vorlieben gestellt». Die Rollen sind Stéphane Degout, Gyula Orendt und Barbara Hannigan auf den Leib geschrieben, aber selbstverständlich nicht ausschliesslich für sie. «Ich liebe es und bin gespannt, welche eigenen Timbres und Charakteristika andere Sänger:innen in diese Rollen einbringen. Es ist mir aber wichtig, dass sie alle Töne klar und am richtigen Platz singen, mit wenig Vibrato. Denn ich habe sie sehr sorgfältig auf die Orchesterklänge abgestimmt.»
George Benjamin, Martin Crimp und Barbara Hannigan im Gespräch zur Uraufführung von Lessons in love and violence im Royal Opera House 2018
Das Libretto stammt wie auch bei seinen anderen Bühnenwerken vom Dramatiker Martin Crimp. Wenn er ihn nicht getroffen hätte, hätte er wahrscheinlich nie eine Oper komponiert, sagt Benjamin, «ich wartete 25 Jahre um ihn zu finden. Alle Versuche mit anderen Librettisten scheiterten». Nun sind sie ein eingespieltes, kongeniales Team, vielleicht ähnlich wie einst Da Ponte und Mozart, Hofmannsthal und Strauss. Denn auch Crimp und Benjamin verbinden gemeinsame ästhetische Prämissen: Eine sehr klare und konzise (Ton-)Sprache sowie Kraft – oder Gewalt – im Ausdruck. «Er setzt die Worte sehr genau und intendiert; er ist ein Perfektionist, so wie ich es beim Komponieren auch zu sein versuche», sagt der Siemens-Musikpreisträger bescheiden.
Märchenhaftere neue Oper
George Benjamins viertes Bühnenwerk wird diesen Sommer am Opernfestival in Aix-en-Provence uraufgeführt, er selbst wird dirigieren. Picture a day like this wird weniger dunkel sein als Lessons, verrät er: «Martin Crimp und ich wollten etwas anderes machen, auch um uns selbst zu erfrischen. Diese Oper ist kürzer und auch kleiner besetzt, fünf Protagonist:innen anstatt acht, im Orchester 22 anstatt 70 Musizierende».
Hier geht es um eine Suche: Eine Frau verliert ihr Kind und soll an einem einzigen Tag eine Person finden, die vollkommen glücklich ist. Als ihr das nicht gelingt, wendet sie sich an eine Zauberin. «Ich liebe Instrumente, die eigentlich nicht zum klassischen Orchester gehören, und verwende auch in Picture a day like this ein paar davon, zum Beispiel Tenor- und Bassblockflöten.» In dieser neuen und auch kürzeren Oper ist die Protagonistin die ganze Zeit auf der Bühne, was ebenfalls ein Novum ist für Benjamin und Crimp. Die Personen, welchen sie begegnet, sind hingegen ganz unterschiedlich charakterisiert. Mehr verrät er noch nicht: «Mir wäre es lieber, wenn das Publikum das ohne meine Worte entdecken würde».
Moritz Weber

Opern George Benjamins:
Into the little hill (2006), Written on skin (2012)
George Benjamin, Charles Wuorinen, Stéphane Degout, Barbara Hannigan, Martin Crimp
Partituransicht Lessons in Love and Violence bei Faber Music
Neuproduktion Opernhaus Zürich: 21.Mai -11.Juni 2023 (musikalische Leitung Ilan Volkov, mit: Ivan Ludlow/Lauri Vasar als König, Björn Bürger als Gaveston und Jeanine De Bique als Isabel.
Festival Aix-en-Provence, George Benjamin, Picture a day like this, UA 5.-.23.Juli 2023
Sendungen SRF 2 Kultur:
Musik unserer Zeit, 17.5.23, 20h/ 20.5.23., 21h: Drama um den schwulen Edward II. George Benjamins düsterste Oper, Redaktion Moritz Weber.
Musikmagazin, 20./21.5.2023: Kurzportrait George Benjamin, Redaktion Moritz Weber.
Neo-Profile:
Contrechamps, Opernaus Zürich, George Benjamin, Andrea Lorenzo Scartazzini