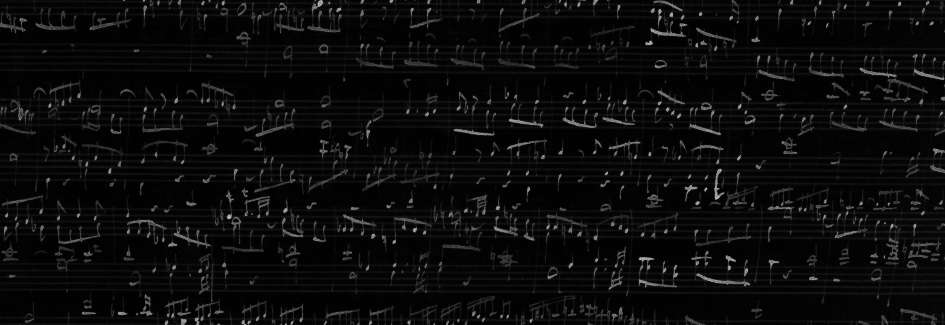Friedemann Dupelius
„Mit welcher Maschine würdest du gerne mal essen gehen (Smartphones zählen nicht)?“ – Leo Hofmann überlegt und entscheidet sich für ein rollendes, selbstspielendes Klavier, auf dem er auch selbst mal spielen kann.
Die Beziehungen zwischen Menschen und Maschinen, oder hipper formuliert: zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteur:innen, sind derzeit ein beliebtes Thema in Kunst und Diskurs, nicht zuletzt ausgelöst durch die neueste Hype-Welle um Künstliche Intelligenz. In ihrem Musiktheater-Stück All watched over by machines of loving grace behandeln der Komponist Leo Hofmann und der Regisseur Benjamin van Bebber diese Relationen in intimen Bühnen-Situationen. 1967 schrieb Richard Brautigan in seinem gleichnamigen Gedicht von einer „cybernetic meadow / where mammals and computers / live together in mutually / programming harmony“, also einer „kybernetische(n) Wiese, auf der Säugetiere und Computer in programmierter Harmonie zusammenleben“.

Die Utopie, die Brautigan beschreibt, entspringt der Hippie-Ära. Die Gegenbewegungen der 1960er-Jahre sahen in der aufkommenden Computertechnologie ein revolutionäres, humanistisches Potenzial für eine bessere Welt. Sogar die Gründungen der ersten Firmen im Silicon Valley lassen sich darauf zurückführen. Lang ist’s her.
Nach einer coronabedingten Film-Premiere von All watched over… im Jahr 2021 feierte das Stück im Mai seine Premiere in physischer Ko-Präsenz im Roxy Birsfelden. Im Juni findet sich der gemischte Chor nochmals für zwei Aufführungen im Berliner Ballhaus Ost zusammen.
Film: All watched over by machines of loving grace
Menschliche und nichtmenschliche Klangkörper
Wie die Technologien des 21. Jahrhunderts unser Zusammenleben verändern, davon handelt das Musiktheater All watched over…. Dabei geht es insbesondere um Klang. Wie lässt sich inmitten der omnipräsenten Dauerbeschallung verantwortungsvoll handeln? Wo entsteht Raum für Intimität? Und was ist das mit den Maschinen und uns? Der „extrem gemischte Chor“, den Hofmann und van Bebber für ein anderes Projekt gegründet hatten, stellt den menschlichen Part der Akteur:innen auf der Bühne. Extrem gemischt heißt, dass hier Profis und sogenannte Laien mit unterschiedlichsten Hintergründen singen. Hinzu kommen nichtmenschliche Klangkörper, etwa Lautsprecher. Hier zeigt sich ein Spezifikum der Arbeit Hofmanns und van Bebbers. „Ich bin elektronischer Komponist und denke vom Hörspiel und vom Lautsprecher aus“, sagt Leo Hofmann. „Wenn man mit fertiger Musik arbeitet, schafft das eine neue Freiheit auf der Bühne. Es stellt sich die Frage nach einer Ko-Präsenz in der Inszenierung.“
Dafür haben Hofmann und van Bebber für sich den Begriff der „Ergänzungshandlung“ gefunden. Was machen befreite Körper, wenn die Musik aus dem Lautsprecher kommt und nicht erst performt werden muss? Die Performer:innen werden zu ko-präsenten Vermittler:innen der Musik und können durch kleine Handlungen und Gesten die Aufmerksamkeit auf bestimmte musikalische Details lenken. Einen anderen Begriff finden die Musiktheatermacher beim Prinzip des „Ritournelle“ von den Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari. Demnach eröffnet sich die Option, einen eigenen akustischen Handlungsraum zu schaffen, etwa indem der oder die Performer:in durch leises Summen oder Murmeln ein inneres Sicherheitgefühl etabliert, aus dem heraus der Chor in All watched over… improvisatorisch agieren kann. Leo Hofmann spricht gern von einem Hörraum, in den Performer:innen und Publikum gemeinsam eintreten und in dem dadurch eine „geteilte Aufmerksamkeit“ entstehe.
Leo Hofmann: Ritournelle
Gastfreundschaft im Musik-Haushalt
Einen solchen Hörraum richtet das Duo auch im Juli bei den Musikinstallationen in in Nürnberg ein. Das Festival findet erstmals statt und möchte den Raum als zentrales Erfahrungsmoment von Musik erforschen – in bewusster Abgrenzung zu Formen wie Klanginstallation, Musiktheater oder Konzert. Leo Hofmann interpretiert die Vorgabe so: „Darin liegt für mich ein Versprechen, dass durchgehend Musik von agierenden Körpern produziert wird, die aber instabil sind.“ Wobei, könnte nicht schon eine Bar mit Hintergrundbeschallung, mit dem richtigen Framing als Musikinstallation bezeichnet werden? Anyway, bei Hofmann und van Bebber erklingt die Musik live. Für die vier Festivaltage nisten sie sich in den kollektiven Räumlichkeiten der Nürnberger Band Borgo ein und haben verschiedene Musiker:innen zu Gast. „Wir möchten Gastfreundschaft auf verschiedenen Ebenen verhandeln. Es wird kein Werk, kein Totalraum, sondern wir leben, schlafen und essen für vier Tage in diesem Raum, machen ein Tagesprogramm und unsere Gast-Musiker:innen bringen mit, was sie schon haben“, erzählt Leo Hofmann. Die Composer-Performerin Francesca Fargion etwa komponiert Schlafsongs und arbeitet mit ästhetisierten Tagebüchern. Ein Besuch bei Hofmann/van Bebber soll wie ein Hausbesuch funktionieren. Im Gegensatz zu oft autark laufenden Klanginstallationen wird dieser musikalische Haushalt erst durch seine Bewohner:innen und Gäste klanglich aktiviert. Das Publikum ist selbstverständlich ebenso in diesen Raum geteilter Aufmerksamkeit eingeladen.
Leo Hofmann: Kapriole, erschienen 2022 bei Präsens Editionen
Intime Kapriolen
Eine andere Art inszenierter Hörräume verewigte Leo Hofmann im Frühjahr 2022 auf Vinyl-Platte. Zwar ist der Absolvent der Hochschule der Künste Bern in den letzten Jahren vor allem mit seinen Musiktheater-Produktionen in Erscheinung getreten, doch schon viel früher hatte er Hörspiele und Musik produziert. Kapriole ist dennoch sein erstes „richtiges“ Musik-Album und erscheint beim umtriebigen Luzerner Label Präsens Editionen. Verteilt auf acht Tracks zeigt Leo Hofmann seine Interpretation zeitgenössischer Soundpraktiken. In seinen Live-Stücken setzt er sich häufig mit haptischen Audiotechnologien aus dem Consumerbereich, also beispielsweise Bluetooth-Boxen, auseinander. Vor allem interessiert ihn deren ästhetische und soziale Bedeutung – welche Hör-, Schutz- und Privaträume eröffnet zeitgenössische Audiotechnologie?

Die Musik auf Kapriole klingt intim und nah, auch durch den behutsamen Einsatz von Stimme, die mitunter so wirkt, als sänge oder spräche sie nur für die Hörer:in selbst. Hofmann erzählt, dass die größte Herausforderung für ihn war, Platz im Hörraum zu schaffen. „Ich höre oft, dass meine Musik sehr dicht ist und viel Aufmerksamkeit erfordert. Bei der Arbeit an dem Album habe ich immer wieder entdichtet, weggenommen und Klänge im Hintergrund gelassen. Aber man soll auch jederzeit hinhören und etwas entdecken können.“ Ob in geteilter Aufmerksamkeit vor der Musiktheaterbühne oder auf der inneren Bühne zwischen zwei Ohrstöpseln: In den Hörräumen von Leo Hofmann kann man sich aufgehoben fühlen.
Friedemann Dupelius
11.+12. Juni, Ballhaus Ost, Berlin: Leo Hofmann & Benjamin van Bebber: All watched over by machines of loving grace
Hofmann/van Bebber im Interview über All watched over…
7.-10. Juli: Musikinstallationen Nürnberg – Festival for Space Time Body Musics
Leo Hofmann, Benjamin van Bebber, Präsens Editionen, Richard Brautigan, Gilles Deleuze, Félix Guattari
neo-Profil: Leo Hofmann